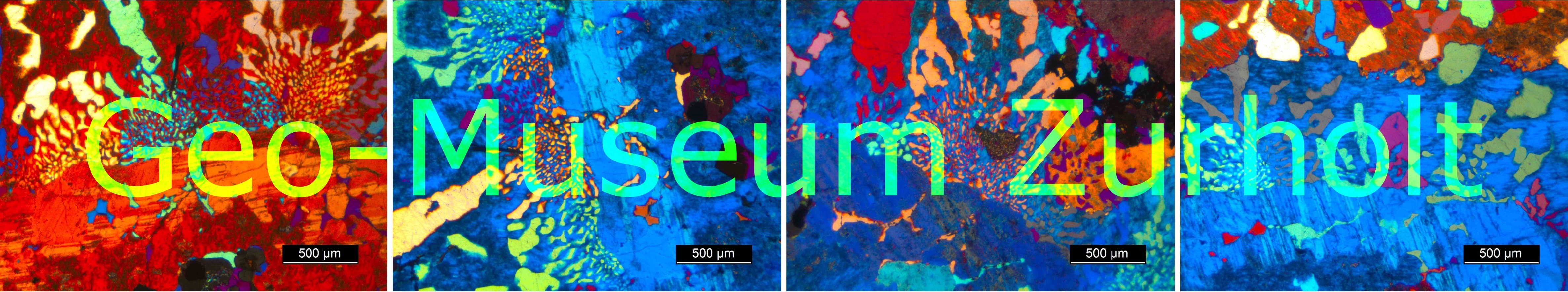Seeigel & Seesterne
Seeigel (Echinoidea)
 Echinoidea, Inv. Nr. 24
Echinoidea, Inv. Nr. 24
Abb.: Irregulärer Seeigel, Echinocorys sp., Schalenerhaltung, Foto: E. Müsch, Bild öffnen
Zeitstellung: Campan
Fundort: Altenberger Höhenrücken
 Echinoidea, Inv. Nr. NN
Echinoidea, Inv. Nr. NN
Abb.: Irregulärer Seeigel, Echinocorys scutata, Schalenerhaltung, 4-Ansichten, Foto: E. Müsch, Bild öffnen
Zeitstellung: ??
Fundort: Altenberge, Laerstraße, Neubau Rettungswache
Vollständige Exemplare sind sehr selten, häufiger finden sich Schalenbruchstücke.
Seesterne (Asteroidea)
 Bestimmung??, Inv. Nr. H099
Bestimmung??, Inv. Nr. H099
Abb.: Seestern, Schalenerhaltung, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen
Zeitstellung: Campan
Fundort: Altenberger Höhenrücken, Neubau-Industriegebiet "Regional - Gut Altenberge"
Dabei handel es sich hier um einen in der Region sehr seltenen Fund von Gliedern eines Seesterns.
Hier finden Sie weitere Informationen vom Arbeitskreis Paläontologie Hannover (APH) über Seeigel und Seesterne
Schwämme (Porifera)
Kalkschwamm
 Inv. Nr. 10
Inv. Nr. 10
Abb.: Kalkschwamm, Ventriculites radiatus, Steinkern (oben), Abdruck (unten), Foto: E. Müsch, Bild öffnen
Zeitstellung: Santon-Campan
Fundort: Altenberger Höhenrücken
Kalkschwamm
 Inv. Nr. 21
Inv. Nr. 21
Abb.: Kalkschwamm, Phymatella tuberrosa?, Steinkern, Foto: E. Müsch, Bild öffnen
Zeitstellung: Campan
Fundort: Altenberger Höhenrücken (Sendhügel)
Kalkschwamm
 Inv. Nr. 25
Inv. Nr. 25
Abb.: Kalkschwamm, Jereica oligostoma, Ansicht Unterseite, Steinkern, Foto: E. Müsch, Bild öffnen
Zeitstellung: Campan
Fundort: Altenberger Höhenrücken (Sendhügel)
Kalkschwamm

 Inv. Nr. E01M
Inv. Nr. E01M
Abb.: Kalkschwamm, Amphithelion Macromata, Links: Oberseite, Rechts: Unterseite,
Foto: E. Müsch, Bild (Oberseite) öffnen, Bild (Unterseite) öffnen
Zeitstellung: Campan
Fundort: Altenberger Höhenrücken (Sendhügel)
Schwämme sind als Abdrücke bzw. zusammengedrückte Exemplare auf Steinplatten und im Mergel relativ häufig. Sehr selten sind dagegen vollvolumige, vollständig erhaltene Exemplare wie die Beispiele oben. Die Bestimmung ist nicht einfach, da Schwämme von derselben Art je nach Lebensbedingungen sehr variabel aussehen können.
Im Folgenden finden Sie weitere Funde aus der Industrieansiedlung Regional-Gut Altenberge und aus dem neuen Baugebiet Krüselblick II:
Kalkschwamm
 Inv. Nr. H102
Inv. Nr. H102
Abb.: Kalkschwamm, Abdruck, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen
Zeitstellung: Campan
Fundort: Altenberger Höhenrücken (Industriegebiet Regional-Gut Altenberge)
Kalkschwamm
 Inv. Nr. H99
Inv. Nr. H99
Abb.: Kalkschwamm, Abdruck, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen
Zeitstellung: Campan
Fundort: Altenberger Höhenrücken (Industriegebiet Regional-Gut Altenberge)
Kalkschwamm
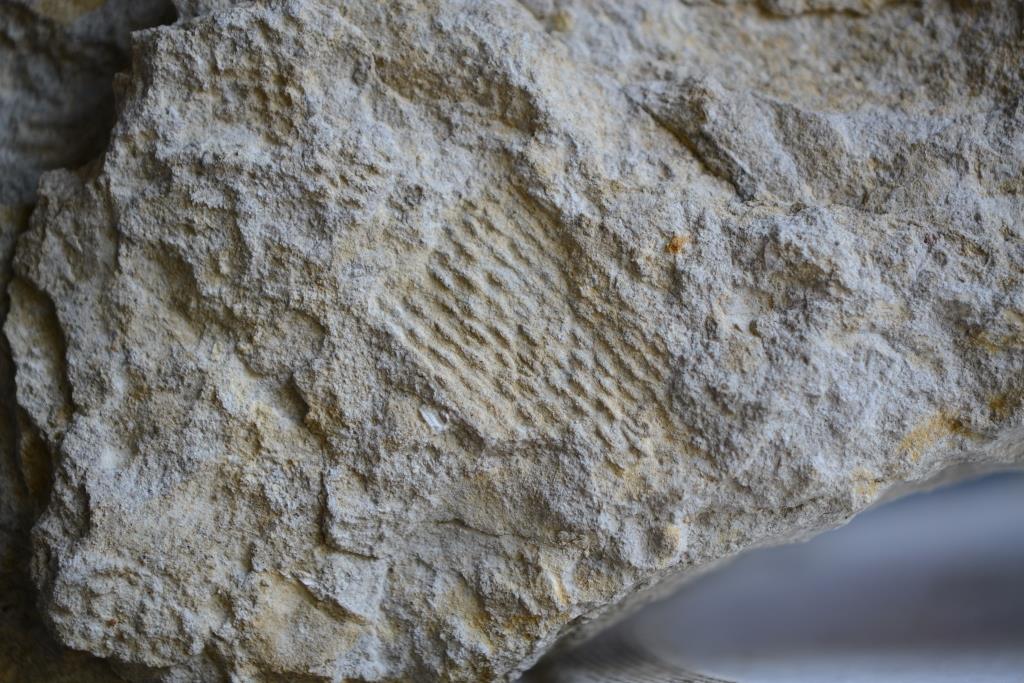 Inv. Nr. H102
Inv. Nr. H102
Abb.: Kalkschwamm, Abdruck, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen
Zeitstellung: Campan
Fundort: Altenberger Höhenrücken (Industriegebiet Regional-Gut Altenberge)
Kalkschwamm
 Inv. Nr. H101
Inv. Nr. H101
Abb.: Kalkschwamm, Abdruck, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen
Zeitstellung: Campan
Fundort: Altenberger Höhenrücken (Industriegebiet Regional-Gut Altenberge)
Kalkschwamm
 Inv. Nr. H098
Inv. Nr. H098
Abb.: Kalkschwamm, Camerospongia oder Stichophoma, Abdruck mit Mergel gefüllt, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen
Zeitstellung: Campan
Fundort: Altenberger Höhenrücken (Industriegebiet Regional-Gut Altenberge)
Kalkschwamm

 Inv. Nr. H114
Inv. Nr. H114
Abb.: Kalkschwamm, Abdruck mit Mergel gefüllt, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Linkes Bild öffnen Rechtes Bild öffnen
Zeitstellung: Campan
Fundort: Altenberger Baugebiet Krüselblick II
Kalkschwamm
 Inv. Nr. H116
Inv. Nr. H116
Abb.: Kalkschwamm, Abdruck mit Mergel gefüllt, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen
Zeitstellung: Campan
Fundort: Altenberge Baugebiet Krüselblick II
Kalkschwamm


 Glypticus sulcatus, Inv. Nr. H125
Glypticus sulcatus, Inv. Nr. H125
Abb.: Astylospongia praemorsa, Steinkernerhaltung, 3 Fotos: Dr. H.-G. Hettwer, Bild oben öffnen, Bild Mitte öffnen, Bild unten öffnen
Zeitstellung: Silur, Ordovizium
Fundort: Altenberger Höhenrücken, Neubaugebiet Krüselblick II
Weitere Informationen zu Astylospongia praemorsa in: Geologisches Museum Münster, Fossilienforum The Fossil Forum.
Kalkschwamm
 Inv. Nr. NN
Inv. Nr. NN
Abb.: Kugelschwamm Porosphaera globularis, Steinkernerhaltung, Foto: Eugen Müsch, Bild öffnen
Zeitstellung: Campan
Fundort: Altenberge, Laerstraße, Neubau Rettungswache
Hier finden Sie weitere Informationen vom Arbeitskreis Paläontologie Hannover (APH) über Schwämme.
Röhrenwürmer (Vermes)
Wurmgehäuse Röhrenwurm
 Hamulus sexangularis, Inv. Nr. 1
Hamulus sexangularis, Inv. Nr. 1
Abb.: Gehäuse Röhrenwurm, Hamulus sexangularis, Wurmgehäuse auf Matrix, Foto: E. Müsch, Bild öffnen
Zeitstellung: Santon-Campan
Fundort: Altenberger Höhenrücken
 Hamulus sexangularis, Inv. Nr. NN
Hamulus sexangularis, Inv. Nr. NN
Abb.: Gehäuse Röhrenwurm, Hamulus sexangularis (?), Wurmgehäuse auf Matrix, Foto: E. Müsch, Bild öffnen
Zeitstellung: Santon-Campan
Fundort: Altenberger Höhenrücken
Röhrenwürmer besitzen keine Schale oder Skelett. Daher sind auch keine fossilien Würmer bekannt. Hingegen findet man öfter fossile Wurmgänge oder die gehäuseähnliche Außenhaut als Fossil.
Muscheln (Bivalvia)
Muschel
 Inv. Nr. 26
Inv. Nr. 26
Abb.: Muschel, Inoceramus sp., Steinkernerhaltung, Foto: E. Müsch, Bild öffnen
Zeitstellung: Campan
Fundort: Altenberger Höhenrücken
Muschel
 Inv. Nr. 27
Inv. Nr. 27
Abb.: Muschel, Inoceramus haldemensis?, Schalenerhaltung, Foto: E. Müsch, Bild öffnen
Zeitstellung: Campan
Fundort: Altenberger Höhenrücken
Muschel
 Inv. Nr. 30
Inv. Nr. 30
Abb.: Muschel, Inoceramus crispi, Steinkernerhaltung, Positiv- und Negativabdruck, Foto: E. Müsch, Bild öffnen
Zeitstellung: Campan
Fundort: Altenberger Höhenrücken
Muschel
 Inv. Nr. H132
Inv. Nr. H132
Abb.: Muschel, Inoceramus crispi, Schalenerhaltung, Positiv- und Negativabdruck, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen
Zeitstellung: Campan
Fundort: Altenberger Höhenrücken
Muschel
 Inv. Nr. H133
Inv. Nr. H133
Abb.: Muschel, Inoceramus crispi, Steinkernerhaltung, Abdruck, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen
Zeitstellung: Campan
Fundort: Altenberger Höhenrücken
Muschel
 Inv. Nr. H098
Inv. Nr. H098
Abb.: Muschel, ??, Schalenerhaltung, , Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen
Zeitstellung: ??
Fundort: Altenberger Höhenrücken (Neubaugebiet "Regional - Gut Altenberge")
Muschel
 Inv. Nr. H100
Inv. Nr. H100
Abb.: Muschel, ??, Schalenerhaltung, , Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen
Zeitstellung: ??
Fundort: Altenberger Höhenrücken (Neubaugebiet "Regional - Gut Altenberge")
Muschel
 Inv. Nr. H101
Inv. Nr. H101
Abb.: Muschel, ??, Schalenerhaltung, , Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen
Zeitstellung: ??
Fundort: Altenberger Höhenrücken (Neubaugebiet "Regional - Gut Altenberge")
Muschel
 Inv. Nr. H101
Inv. Nr. H101
Abb.: Muschel, ??, Schalenerhaltung, , Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen
Zeitstellung: ??
Fundort: Altenberger Höhenrücken (Neubaugebiet "Regional - Gut Altenberge")
Muschel
 Inv. Nr. H117
Inv. Nr. H117
Abb.: Muschel, ??, Schalenerhaltung, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen
Zeitstellung: ??
Fundort: Altenberger Neubaugebiet Krüselblick II
Muschel
 Inv. Nr. H117
Inv. Nr. H117
Abb.: Muschel, ??; Schalenerhaltung, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen
Zeitstellung: ??
Fundort: Altenberger Neubaugebiet Krüselblick II
Muschel
 Inv. Nr. H119
Inv. Nr. H119
Abb.: Muschel, ??, Schalenerhaltung, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen
Zeitstellung: ??
Fundort: Altenberger Neubaugebiet Krüselblick II
Muschel
 Inv. Nr. H124
Inv. Nr. H124
Abb.: Muschel, Spondylus spinosus(?), Abdruck im Mergelstein, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen
Zeitstellung: ??
Fundort: Altenberger Neubaugebiet Krüselblick II, 2017
Muschel
 Inv. Nr. NN
Inv. Nr. NN
Abb.: Muschel Inoceramus im Mergelstein, Schalenerhaltung, Foto: E. Müsch, Bild öffnen
Zeitstellung: ??
Fundort: Altenberge, Laerstraße, Neubau Rettungswache
Muschel
 Inv. Nr. NN
Inv. Nr. NN
Abb.: Muschel (unbestimmt), Schalenerhaltung, Foto: E. Müsch, Bild öffnen
Zeitstellung: ??
Fundort: Altenberge, Laerstraße, Neubau Rettungswache
Geschiebe aus kompaktem Schillkalkstein (Schalen von Muscheln oder Muschelkrebsen)
Fossiler Schillkalk

 Inv. Nr. NN
Inv. Nr. NN
Abb.: Kalkstein aus fossilem Muschelschill, Platte 7 cm Kantenläge, links: poliert, rechts: unbehandelt, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, linkes Bild öffnen, rechtes Bild öffnen
Zeitstellung: ??
Fundort: Altenberger Regenrückhaltebecken in Richtung Havixbeck, Neubau 2017
Fossiler Schillkalk

 Inv. Nr. 129
Inv. Nr. 129
Abb.: Fossiler Schillkalkstein, Dicke halbiert (gesägt) und poliert, links: Schnittfläche, rechts: gegenüberliegende Schnittfläche Foto: Dr. H.-G. Hettwer, linkes Bild öffnen, rechtes Bild öffnen
Zeitstellung: ??
Fundort: Altenberger Regenrückhaltebecken in Richtung Havixbeck, Neubau 2017
Fossiler Schillkalk
 Inv. Nr. 130
Inv. Nr. 130
Abb.: Fossiler Schillkalkstein, Poliert, Foto: Dr. H.-G. Hettwer, Bild öffnen
Zeitstellung: ??
Fundort: Altenberger Regenrückhaltebecken in Richtung Havixbeck, Neubau 2017
Muscheln
Muscheln gehören wie die Schnecken (Gastropoden) und Kopffüßler (Cephalopoden) zu den Weichtieren (Mollusken). Sie entstanden erstmals im Kambrium vor ca.500 Millionen Jahren. Ein vorläufiges Artenmaximum erreichten die Muscheln in der oberen Kreidezeit, bevor sie am Ende der Kreidezeit vor 65 Millionen Jahren ebenfalls massiv vom Artensterben betroffen wurden. Im Laufe des Tertiärs erholte sich die Artenvielfalt und heute existieren Schätzungen zufolge 8000 - 10000 Muschelarten, mehr als zu irgendeiner anderen Zeit der Erdgeschichte. Einige Muschelarten überleben unglaublich lange Zeiträume unverändert. Muschelarten, die evolutionsbedingt nach nur 300.000 – 1 Mio. Jahre ausstarben, eignen sich hervorragend als Leitfossilien.
Die Lebensweise von Muscheln ist recht unterschiedlich. Neben im Meeresboden grabenden Muscheln existieren freibewegliche und stationäre Muscheln (z. B. Austern), die fest mit dem Untergrund verbunden sind sowie Bohrmuscheln. Je nach Art ernähren sie sich von organischen Abbaustoffen, von Plankton und Algen oder profitieren von symbiotischer Lebensweise mit Bakterien. Es gibt sogar Raubmuscheln, die Jagd auf Kleinkrebse machen.
Ihrerseits spielen Muscheln in der Nahrungskette eine wichtige Rolle. Charakteristisch ist das Gehäuse aus zwei Schalen, deren chemischer Aufbau aus Aragonit (Perlmutt) und/oder aus Calcitschichten besteht. Im Altenberger Höhenrücken kommen die Muschelschalen mit hohem Calcitanteil häufig in Schalenerhaltung vor. Für stark aragonithaltige Schalen liegen keine guten Erhaltungsvoraussetzungen vor, so dass auch Muscheln in Steinkernerhaltung zu finden sind. Da die Schließmuskeln und das Schlossband nach dem Tod des Tieres schnell vergehen, zerfallen Muscheln meist in Folge von Strömung und Brandung in zwei Schalenhälften. Ganze Exemplare sind daher selten. Stellenweise häufig sind Bruchstücke von Muschelschalen, hier vor allem von der Art Inoceramus sp, die offensichtlich lokal Muschelbänke bildeten. Inoceramusschalen dienten wiederum anderen Muscheln, wie z.B. der relativ kleinen und sehr variablen Austernart Hyotissa semiplana als Befestigungsunterlage. Die Inoceramen, wie auch die im Altenberger Höhenrücken vorkommenden Austernarten Pycnodonte versicularis und Hyotissa semiplana, sind mit dem Ende der Kreidezeit ausgestorben.
Viele der hier gezeigten Muscheln wurden in einer Position fossilisiert, in der die konkave Seite nach oben zeigt. Dieser Befund erlaubt einen interessanten Rückschluss auf die Sedimentationsbedingungen, die zur Zeit der Fossilbildung herrschten, siehe [1982Gall]. Denn nur in einem ruhigen Flachwasserbereich erfolgt die Fossilbildung in dieser Position. Denn ist das Wasser stärker turbulent, werden Muscheln nach dem Absterben fortgetragen und setzten sich mit der offenen Seite nach unten ab. Der hier oft beoachtete Befund bestätigt die Auffassung darüber, dass während der Kreidezeit Altenberge und das Münsterland von einem ruhigen Flachwassermeer bedeckt war.
Hier finden Sie weitere Informationen vom Arbeitskreis Paläontologie Hannover (APH) über Muscheln.
Muschelschill, Schillkalk oder auch Trochitenkalk
Diese Bezeichnungen stehen für einen fossil-reichen Kalkstein, der überwiegend aus Versteinerungen abgestorbener Tiere des Erdzeitalters Trias/Muschelkalk besteht (Muscheln, Schnecken, Seelilien). Indem die Hohlräume zwischen den Bruchstücken durch auskristallisierende Kalkschlämme gefüllt werden, bildet sich ein fester kompakter Kalkstein, in den die Fossilien eingebettet sind. Die gefundenen Einzelstücke sind hier als eiszeitliches Geschiebe abgeladen worden, aber nicht hier entstanden. Solche Gesteine können einen Fossil-Anteil von über 50 Gewichtsprozent aufweisen [1982Gall]
Minerale
Calcit
 Inv. Nr. NN
Inv. Nr. NN
Abb.: Calcit-Kristalle als Kluftmineral im Altenberger Stein, Foto: E. Müsch, Bild öffnen
Zeitstellung: ??
Fundort: Altenberge, Bahnhofstraße, Hanglage
Calcit
 Inv. Nr. NN
Inv. Nr. NN
Abb.: Calcit (Kalzit) Kristalle als Kluftmineral im Altenberger Stein, Foto: E. Müsch, Bild öffnen
Zeitstellung: ??
Fundort: Altenberge, Bahnhofstraße, Hanglage
Granate aus Altenberge
 Inv. Nr. NN
Inv. Nr. NN
Abb.: Einzelne, bis zu 4 mm große Granate aus Granatgranulit-Gestein (Eiszeitgeschiebe, siehe unten), Präparation und Foto: E. Müsch, Bild öffnen
Fundort: Altenberge, Neubau Industriegebiet Altenberge Süd in 2022
Granatgranulit-Gestein mit freigelegten Granaten
 Inv. Nr. NN
Inv. Nr. NN
Abb.: Granatgranulit-Gestein (Eiszeitgeschiebe, siehe unten), Präparation und Foto: E. Müsch, Bild öffnen
Fundort: Altenberge, Neubau Industriegebiet Altenberge Süd in 2022