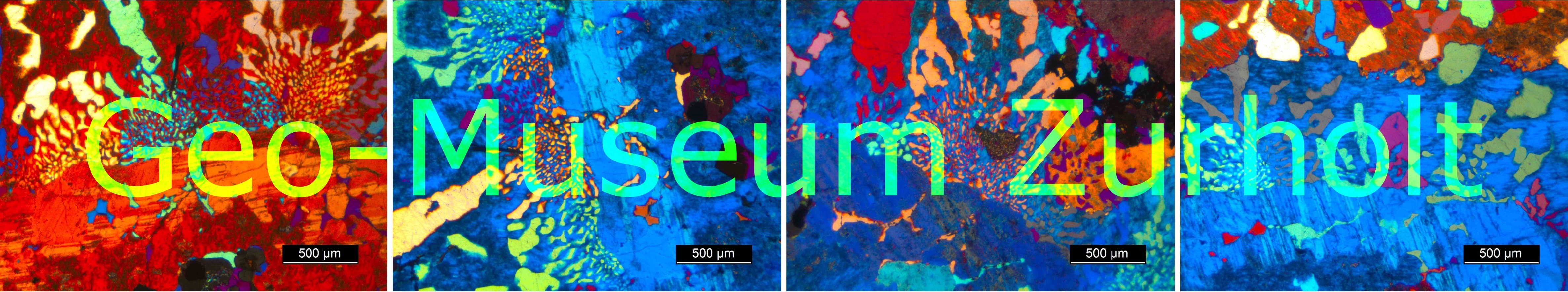uncategorised
3D-Modell der Kristallstruktur des Minerals Calcit
Strukturmodell von Calcit (Chemische Formel: CaCO3). Darstellung der Atome: Weiß: Calzium (Ca), Schwarz: Kohlenstoff (C), Rot: Sauerstoff (O). Zum Drehen des Modells verwenden Sie Ihre Maus oder nutzen Sie die Touch-Funktionen Ihres Mobilgeräts.
Das Mineral Calcit ist bei Sammlern und in der Mineralogie auch unter dem Namen Doppelspat, Kalkspat oder auch einfach als Kalkstein bekannt. Das Strukturmodell ist dabei die Darstellung des perfekt gebauten Minerals. In der Natur findet man dagegen das Mineral nur selten ohne Störungen im Strukturaufbau (Zwillingsbildung) und ebenso selten als klare Kristalle. Ursache ist die Einlagerung von Fremdatomen, die zur Trübung und Färbung der ansonsten durchsichtigen Kristalle führt.
Heutzutage verweist man mit der Bezeichnung Calcit auf das Mineral und mit der Bezeichnung Kalkstein auf ein Calcit-haltiges Gestein mit zumeist sedimentären Ursprung.
3D-Modell eines Feuersteins
Das 3D-Modell unten ist eine Rekonstruktion eines Feuersteins aus dem Erdaushub des Regenrückhaltebeckens beim Neubau der Firma Wecon mit den Abmessungen 24 x 20 x 10 cm, rund 2,3 kg schwer.
Vom realen Modell des Feuersteins wurden ein Smartphone-Video erstellt und daraus 446 Fotos mit einer Auflösung von 1920x1080 exportiert. Hieraus wurde dann das 3D-Modell unten erstellt.
Zum Drehen und Zoomen des 3D-Modells verwenden Sie linke Maustaste und Scroll-Rad, oder nutzen Sie die Touch-Funktionen Ihres Mobilgeräts.
3D-Modell des Belemnitenschlachtfelds
Das 3D-Modell unten ist eine 3D-Rekonstruktion des Kalksteins Belemniten-Schlachtfeld aus der Ausstellung des Museums mit den Abmessungen 128 x 90 x 45 cm, rund 1000 kg schwer.
Vom Fundstück wurden 113 Digitalkamera-Fotos mit einer Auflösung von 4608x3072 mittels einer gewöhnlichen Spiegelreflex-Kamera erstellt. Das daraus errechnete 3D-Modell enthielt 1,7 Mio. Kanten bzw. 3,5 Mio. Flächen, was für die Veröffentlichung im Internet viel zu groß ist. Daher haben wir die Datenmenge der Modell-Rekonstruktion um 90% reduziert auf ca. 357.000 Kanten bzw. 712.000 Flächen, was zwar die Detailauflösung verschlechtert, aber erst so zu erträglichen Ladezeiten führt.
Zum Drehen und Zoomen des 3D-Modells verwenden Sie linke Maustaste und Scroll-Rad, oder nutzen Sie die Touch-Funktionen Ihres Mobilgeräts.
Virtuelles Museum - Virtuelle Welten
3D in Geologie, Mineralogie und Paläontologie
Für Künstler und Museen ist das Präsentieren der Werke und Exponate schon immer eine zentrale Aufgabe, einerseits um Besucherinnen und Besucher anzusprechen, andererseits möchte man das Erlebnis auch einem größeren Besucherkreis zugänglich machen. So sind neben den Print-Medien heutzutage Internet und Social-Media-Plattformen aus Kunst und Kuktur nicht mehr wegzudenken. Neu an dieser Entwicklung ist, das mit Virtual Reallity und 3D sich für Kunst und Kultur ganz neue Möglichkeiten eröffnen.
Mit der Entwicklung der 3D-Technik, hier in Form der Photogrammetrie und 3D-Rekonstruktion, hat sich in den letzten Jahren ein ganz neuer Zweig entwickelt, durch den es möglich ist, aus einfachen Bilderserien (Handy, Digitalkamera) virtuelle Kopien eines 3D-Modells herzustellen. Damit lassen sich Objekte wie in einem "virtuellen Museum" zugänglich machen.
Virtuelle 3D-Modelle kann man dann bequem vom Sofa aus intuitiv mit Maus oder Wisch-Gesten drehen und in die Darstelung hinein zoomen. So wird jedes Museum ein Stückchen mehr barrierefrei.
Für alle die sich über die dahinterstehende Technik informieren möchten, haben wir eine kurze Einführung vorbereitet
(3D-Modellierung - was ist das?).
Einige Exponate aus dem Museum sind jetzt Online zu sehen.

Abb.: Kamerapositionen der Fotoserie "Belemnitenschlachtfeld"
Das Museum Zurholt zeigt auf seinen Seiten mittels 3D-Rekonstruktion erstellte Kopien realer Modelle, die der Besucher auf seinem Computer, Tablet oder Smartphone um 360 Grad drehen kann. Hier einige Beispiele:
3D "Belemnitenschlachtfeld"
3D Feuerstein
3D Kristallstruktur von Calcit
3D Calcit-Gestein
3D Ammonit Scaphites Binodosus
3D Kettenkoralle
3D-Modell Steinzeit Feuerstein-Klinge
Wir wünschen viel Spass.